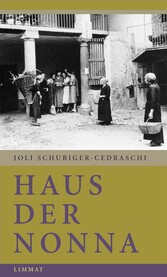
Haus der Nonna - Aus einer Kindheit im Tessin
von: Joli Schubiger-Cedraschi
Limmat Verlag, 2016
ISBN: 9783038550563
Sprache: Deutsch
144 Seiten, Download: 1076 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Briefe der Nonna. Ruhiger Abend und verwunschener Morgen. Die «sciuri».
Jede Woche schrieb die Nonna meinem Vater einen Brief. Aus einem Schrank, in dem sie auch das Gebetbuch und den schwarzen Schleier für die Kirche aufbewahrte, nahm sie Feder und Tinte. Dann setzte sie sich eine Brille auf. Es war ihr nicht wichtig, ob es die eigene Brille war oder die von Nonno Pepp. Sie schrieb sehr langsam und in klaren Formen auf einen linierten Schreibblock. Die Augen hatte sie dabei fast auf dem Papier.
Ich weiss, dass ihre Blätter in Zürich dann lange auf dem Küchenschrank herumlagen. Meine Mutter räumte sie schliesslich zusammen mit alten Zeitungen weg. Ein paar Briefe aber hat mein Vater aufbewahrt. Sie fangen mit Sätzen an wie: «Endlich komme ich dazu, Euch Mitteilung zu machen, dass es der Joli sehr gut geht», und schliessen mit Küssen für meine Mutter, la Pina, und für meine beiden Schwestern und mit einem «besonderen Gruss» für meinen Vater von der «Mama Vittoria». Wie sehr es mich schmerzte, dass meine Mutter mich wegfahren liess, während sie meine Schwestern in ihrer Nähe behielt, habe ich erst aus diesen Briefen wieder erfahren.
Die Nonna erkundigte sich regelmässig nach der Gesundheit meiner Mutter und gab Ratschläge. Sie fragte auch, wie es mit den Händen meines Vaters stehe, die jeden Winter von der Kälte tiefe Risse bekamen. «Es ist nicht gut, dass Du trockenes Brot zu Mittag isst», schreibt sie einmal. Sie schickte Pakete nach Zürich mit Borlottibohnen, mit Mais, Kochspeck, Trauben, Kastanien und manchmal auch mit Mehl und geschmuggeltem Reis. In einem Brief vom 4. November 1940 schreibt sie: «Es ist gut, auch für die Kinder, immer eine Minestra zu haben. Aber jetzt, wo alles knapp ist, weiss ich nicht, wie Ihr es macht. Traurige Zeiten! Das Leben ist so teuer, auch für uns. Aber wenn ich denke, dass Ihr alles kaufen müsst! Lasst es den Kindern nicht am Nötigsten fehlen. Und nehmt alles mit Geduld.»
Ich habe im Tessin ausser der Nonna und Zia Lisa keine alte Frau gekannt, die lesen und schreiben konnte. Zia Maria beispielsweise wusste mit Buchstaben gar nichts anzufangen. Es heisst, die Nonna sei nur etwa drei Jahre, bis zum Tod ihrer Mutter, zur Schule gegangen. Dass Nonno Pepp und seine Brüder besser lesen, schreiben und rechnen konnten als die Frauen, hatten sie vor allem Pá Cesar zu verdanken. Nach jedem Nachtessen, während die Frauen und Mädchen das Geschirr abräumten und spülten, soll er mit ihnen den Schulstoff repetiert haben.
Viele Leute konnten damals nur gerade ihren Namen schreiben. Einige hatten die Buchstaben, die es dazu brauchte, erst vor ihrer Heirat zeichnen gelernt. Sie wollten den Eheschein nicht mit einem simplen Kreuz unterschreiben. Ziu Tugnín hat von einem Analphabeten erzählt, den man in der Osteria häufig über einer ausgefalteten Zeitung sah. Er gab vor, lesen zu können. Einmal soll er die Zeitung verkehrt herum gehalten haben. Der Eisenbahnzug, der darin abgebildet war, hatte die Räder oben, die Dächer unten. Der Mann hielt das Bild für die Darstellung eines Zugunglücks und verbreitete eine schreckliche Nachricht.
Wenn die Nonna schliesslich den fertigen Brief in den Umschlag steckte, war es meist schon recht spät. Hie und da durfte ich einen Gruss daruntersetzen. Ich hielt die Feder, und sie führte meine Hand. Dann war es Zeit für unser gemeinsames Fussbad. Wir gingen jeden Tag in offenen Holzschuhen auf das Feld und hatten abends Erdkrusten an unseren Füssen. Die Nonna goss heisses Wasser, in dem sie vorher oft schon Kartoffeln für die Hühner weichgekocht hatte, in ein altes Blechbecken. Sie sass breitbeinig auf einem niedrigen Stuhl. Der schwarze Rock und die beiden Halbschürzen lagen in einem Wulst über ihren Knien. Ich sass auf dem steinernen Sockel des Kamins und hatte meine Füsse zwischen den ihren. In der Glut stand ein Pfännchen mit frischem Wasser für den Kamillentee, den wir vor dem Schlafengehen tranken.
Unser Fussbad wurde langsam kühl. Wir liessen uns Zeit. Schliesslich nahm die Nonna meine Füsse einen nach dem andern zwischen ihre Knie und trocknete sie mit der Schürze. Der Nonno deckte die Glut, um sie zu bewahren, mit etwas Asche und machte das Kleinholz für den kommenden Tag bereit. Er blieb noch eine Weile sitzen. Die Nonna nahm den weiss emaillierten Kerzenstock vom Kaminsims und zündete die Kerze an. Dann gingen wir in den Hof hinaus.
Auf der dunklen Treppe, die zu den Schlafzimmern führt, blieb ich dicht hinter ihr. Sie trug den Kerzenstock in der linken Hand und hielt mit der rechten die Schürzen und Röcke hoch.
Im oberen Stock warf sie jedes Mal einen riesigen Schatten, der auf der kahlen Wand bis in die Decke wuchs und nach einer Biegung plötzlich verschwand. Über die offene Laube traten wir in ein Zimmer, das auf den Innenhof geht.
Dies sollte später, vor allem während der wärmeren Zeit des Jahres, mein Zimmer sein. Hier war Pá Cesar gestorben. Hier hatte er sich, von einem Unwohlsein befallen, hingelegt, in der Nähe der Nonna, seiner Schwiegertochter, die ihn noch pflegte während der letzten drei, vier Tage. Dass ich in seinem Bett schlafen durfte, habe ich immer als eine Ehre aufgefasst. Und dieses Bett, dieses Zimmer hat mich dann auch, denke ich, besonders fest mit dem Urgrossvater verbunden.
Nun schlief ich aber vorläufig noch bei den Grosseltern im angrenzenden Raum, der mit dem vorderen durch eine einfache Öffnung verbunden war. Ich genoss ihren Schutz und ihre Körperwärme. Die Betten der Grosseltern hatten geschwungene Stirnseiten mit eingelegten Blumen aus dunklerem Holz. Über der hohen hölzernen Welle der Bettstatt, genau in der Mitte, hing ein Bild, schwarz aussen herum und in der Mitte farbig, das den Jesus darstellte, sein strahlendes Herz, umgeben vom offenen Kleid. Die farbigen Stellen glitzerten, weil das durchsichtig bemalte Glas mit Silberpapier hinterlegt war. Die Leintücher waren so über die beiden Matratzen gespannt, dass sich eine einzige grosse Liege ergab. Ich lag unter der Decke und schaute zu den geweisselten Balken und Brettern empor oder zur Nonna hinüber, die jetzt ihren Haarknoten löste. Sie zupfte unzählige Haarnadeln aus ihrem Haar und legte sie auf die Kommode neben den ovalen Spiegel. Dann löschte sie das Licht. Ich hörte das Geräusch ihrer Röcke im Dunkeln. Sie betete halblaut, während sie sich auszog. Es dauerte sehr lange, es reichte für acht, neun, zehn Ave-Maria, bis sie alle Knöpfe und Bändel geöffnet hatte.
Auf dem Kopfkissen der Nonna lag immer ein weisses Tuch, das ich nicht wegnehmen durfte. Sie müsse damit das Kissen schützen, erklärte sie mir, da sie nachts oft plötzlich Nasenbluten habe. «Wieso Nasenbluten?», fragte ich, und sie sagte: «Weil ich schon alt bin.»
Der Nonno kam stets etwas später. Die Nonna mahnte ihn, leise zu sein. Er zog sich viel rascher aus als sie. Ich glaube, er trug zwei Hemden übereinander, und das untere diente gleichzeitig als Nachthemd.
Vor dem Einschlafen dachte die Nonna oft an Cesarín, ihren Sohn, der hier mit uns wohnte. «T’è sentüü ul Cesarín? – Hast du ihn gehört?», fragte sie. Was der Nonno brummte, konnte ja oder nein heissen. Cesarín war etwa achtundzwanzig Jahre alt und lebte noch im Haus seiner Eltern. Abends stand er mit anderen ledigen Männern meist auf der Gasse herum. Die Nonna machte sich Sorgen, wenn sein Schritt einmal nicht zur gewohnten Zeit auf der Treppe zu hören war.
Meine Grosseltern wachten am Morgen sehr früh auf. Manchmal sah ich den Nonno, wie er neben mir lag: auf dem Rücken, mit gestreckten Beinen und Armen, die Nase zur Decke gerichtet. Er glich einem toten Vogel. Die Nonna goss Wasser aus einem Blechkrug in ein Becken, das von einem eisernen Gestell gehalten wurde. Sie wusch sich. Die Hähne krähten sehr laut aus dem Hof. Ich schlief weiter, wohl bis gegen acht Uhr.
Oft kletterte ich dann auf einen Stuhl und schaute durchs Schlafzimmerfenster. Unter mir sah ich den Hühnerhof und die Kaninchenställe und dahinter die Gemüsegärten, die Felder, die Weinberge. Hinter den Weinbergen stand ein bewaldeter Hügel, und hinter dem Hügel lag Italien. Ich schaute durch dieses Fenster über den Rand der Welt hinaus. Manchmal sah ich einer Wolke nach, die über den Hügel zog und dahinter verschwand. «Die ist nun schon in Italien», dachte ich. Dort herrschte jetzt Krieg, und von dort, das wusste ich, kam unsere Familie her.
Dann und wann, das mag später gewesen sein, verweilte ich noch im Schlafzimmer, um mich im Spiegel zu betrachten. Es war ein ovaler, an zwei hölzernen Säulen festgemachter Schwenkspiegel. Darunter ein Sockel mit einer Schublade. Wenn ich auf einen Stuhl kniete, war mein Kopf auf der richtigen Höhe. «Schau nicht zu lange hinein, sonst kommt der Teufel heraus», hatte die Nonna prophezeit. Ich sah mir unentwegt in die Augen und bemerkte, dass mein Blick dabei fremd und dann sogar böse wurde. Dass ich die Warnung der Nonna missachtete, kam ja schon fast einem Bündnis mit dem Bösen gleich. Bald wusste ich nicht mehr, ob ich das noch war oder ob schon der Teufel mir aus meinen Augen entgegenschaute. Gebannt, mit wachsender Spannung liess ich mich in diesen Abgrund hinein. Dazwischen schloss ich kurz die Augen, um mich zu erholen. Ich brach das Spiel erst ab, wenn mich der Schwindel und die Angst fast überwältigten.
Bevor ich dann in die Küche hinunterging, benützte ich den Abort der Lidia, unserer Nachbarin, der von der Laube her zugänglich war. Wir selber hatten hier oben nur Nachttöpfe. Man kauerte über einem Loch wie anderswo auch, aber mitten in schneeweissen Kacheln, die Boden und Wände bedeckten. Schneeweiss war auch die...










