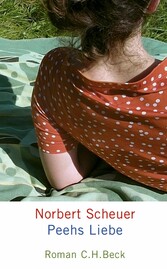
Peehs Liebe - Roman
von: Norbert Scheuer
Verlag C.H.Beck, 2012
ISBN: 9783406639500
Sprache: Deutsch
223 Seiten, Download: 2523 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Teil 2
…
In der Empfangshalle des Altenheims befand sich eine Galerie alter Fotografien des Bergwerkes. Sie zeigten die Verwaltungsgebäude inmitten des Parks, die Aufbereitungsanlagen am Schafsberg, unterschiedliche Förderanlagen, das Hügelland zwischen Kermeter und Kahlenbusch und den Broogberg, wo Strohwang nach seinem Schatz gesucht hatte. Auf den Bildlegenden war zu lesen, dass hier einmal das größte Bleibergwerk Europas gestanden hatte, in dem Hunderte Bergleute beschäftigt waren. Auf einer Fotografie wimmelten sie zahlreich wie Ameisen in einer Grube, auf einer anderen marschierte die musizierende Bergwerkskapelle bei einem Umzug durch Kall. Annie stand in der Empfangshalle, betrachte die historischen Bilder und Ansichtskarten. Verblasste Fotografien von Arbeitern mit Schaufel und Hacke neben einer Lore, Fotografien der Bedienungsmannschaften vor der Dampflok und dem Dampfbagger, von Bergleuten bei Bohrarbeiten zum Vortrieb einer Strecke im Untertagebau, Arbeitern beim Gebet vor der Einfahrt in den Stollen. Auf einer Fotografie sah man Bergassessor Franz Ehring, ein glatzköpfiger Mann mit Hornbrille, an einem Rednerpult bei der Festansprache zum Bergfest. Einige Monate später trat er vor die Belegschaft und verkündete das Ende des Bergbaus in der Eifel. Weitere Fotos zeigten die Sprengung des großen Förderturms, der Aufbereitungsanlagen, des Königspochwerks. Geblieben waren die berghohen Bleisandhalden, der Broogberg und der Malakowturm am Brackwassersee sowie die Verwaltungsgebäude, in denen sich jetzt das Altenheim befand.
…
Eine graue Wolkenschicht lag seit Tagen über der Ebene. Die Truthähne draußen im Garten schienen dieses Wetter zu mögen, sie stolzierten umeinander und plusterten ihr Gefieder auf. Schwester Magda knöpfte vorsichtig das Nachthemd der zierlichen toten Greisin auf, die einmal Balletttänzerin gewesen war. Noch vor zwei Tagen hatte sie im Aufenthaltsraum getanzt. Sie hatte seit Jahren alles vergessen, wusste weder ihren eigenen Namen, noch erkannte sie jemanden wieder. Doch ihr Körper hatte sich nach seinen eigenen Erinnerungen bewegt, nach der Choreografie eines Tanzes, mit dem sie einst auf bedeutenden Bühnen Europas Erfolge gefeiert hatte. Vor Jahren hatte Annie in der Stadt in der Theaterkantine gearbeitet und heimlich bei Proben zugesehen. Sie liebte den staubigen Geruch, der aus den Kulissen strömte, die biegsamen grazilen Körper in Scheinwerferkegeln, die schwebend erschienen wie Elfen.
Annie berührte die dürren Finger und Füße der gerade gestorbenen Frau, spürte den Tod, seine leibhaftige Anwesenheit, wie er unsichtbar umherzuwandeln schien und sich in die Körper schlich, darin heimlich lebte. Sie blickte durch das geschlossene Fenster in den verwilderten Park und weinte.
«Hilf mir endlich», sagte Magda. Annie verstand sich nicht gut mit ihr, wusste, dass sie hinter ihrem Rücken bei den Kolleginnen über sie herzog, weil sie sich zu sehr um Rosarius kümmerte, ihm immer wieder Schreibzeug gab, mit dem Rosarius, nach Magdas Meinung, doch nur sinnloses Zeug kritzelte und ihnen mit seinen Klecksereien unnötige Arbeit machte. Sie fasste vorsichtig unter den Kopf der Tänzerin. Gemeinsam mit Magda drehte sie die Frau zur Seite. Die Haut der Toten hatte eine gelbe Färbung angenommen, nur ihr Rücken wirkte noch lebendig. Während Annie die Tänzerin festhielt, seifte Magda den Waschlappen ein, reinigte Rücken, Gesicht, Hals, Hände und Ohren, trocknete mit dem Handtuch alle Körperstellen gründlich ab, wusch dann Brust, Bauch und Achselhöhlen. Annie suchte im Schrank nach einem schönen Nachthemd, schnitt der Tänzerin die Fingernägel, kämmte ihre Haare und glättete die Augenbrauen mit einem Tupfer Creme, knetete ihre Finger geschmeidig und faltete zuletzt ihre knochigen Hände zusammen. Später kehrte sie allein noch einmal zurück, lackierte die Zehennägel der Tänzerin und cremte ihre kleinen Füße ein.
Peeh wohnte ein Jahr, bis zum Herbst 1952, mit ihrer Mutter bei uns in der Pension, bis sich die Mutter schließlich wieder mit ihrem Mann, dem Apotheker, versöhnte. Sie wollte auch nicht, dass ihr Kind noch länger mit mir zusammen war, sie meinte, Peeh übe nicht genug Klavier, da sie viel lieber mit mir herumstromere. Den Flügel kaufte sie Kathy ab.
Peeh besuchte damals in Kall die Schule, wo ich auch hätte hingehen müssen, wenn ich nicht zu blöde gewesen wäre. Kathy war mit mir wegen meiner Dummheit und Aphasie bei einem Spezialisten in der Stadt gewesen. Der Arzt hatte erklärt, ich hätte nur ein halbes Gehirn, die andere Hälfte, auf der sich normalerweise das Sprachzentrum befinde, sei nur ein milchiger Brei, eine Grütze, die bei mir nur dazu da sei, damit es nicht hohl klinge, wenn man auf meine Schädeldecke klopfe, was er dann auch gemacht hatte. Er hatte dabei gelacht und Kathy zugezwinkert, und es hatte tatsächlich kein bisschen hohl geklungen. So habe ich nie eine Schule besucht, habe auch nicht richtig schreiben gelernt. Ich wäre gern zur Schule gegangen, schon weil Peeh dort war.
Ich war traurig, als Peeh nicht mehr bei uns wohnte, denn ich hatte niemanden mehr, der mit mir spielte. Ich saß stundenlang allein auf dem Waldboden, suchte Muster und Symmetrien, irgendetwas, das sich wiederholte, denn ich mochte es gerne, wenn sich Dinge wiederholten. Ich glaube, alles wiederholt sich, auch wenn wir es nicht merken, denn wenn es anders wäre, könnten wir gar nicht leben. Wenn ich keine Ähnlichkeiten mehr zwischen Dingen sah, schrie und kreischte ich wie ein Irrer. Deswegen und weil ich meine Schnürsenkel nicht binden konnte und immer noch zu klein und zu schmächtig für mein Alter war, ließ man mich nicht in die Schule gehen. Manchmal, wenn eine Fichtennadel vom Waldboden verschwunden war, weil eine Ameise sie weggeschleppt hatte, ging es mir schlecht, stundenlang suchte ich nach der Nadel, denn es war ja eine ganz besondere Nadel, die genau da hingehörte, eine besondere Form und Farbe hatte und so einzigartig wie keine andere Fichtennadel auf der Welt war. Durch Blattwerk fiel Sonnenlicht, das an Zweigen und Spinnweben und auf dem Waldboden leuchtete, wo ich immer noch nach der winzigen Nadel suchte, während über mir Buchfinken, Sommer- und Wintergoldhähnchen sangen, ein Kleiberweibchen geschickt an Baumstämmen auf- und abkletterte und dabei Insekten und Spinnen suchte, die sich in den Ritzen der Borke versteckt hielten. Ich blieb gern bis zum Abend im Wald, dann hingen Sterne an den Zweigen, so unerschöpflich viele wie Fichten, Kiefern- und Tannennadeln, die die Waldböden der ganzen Welt bedecken.
…
Rosarius saß den ganzen Tag an seinem Fensterplatz und sah zu den Truthähnen hinaus, deren Gefieder grau schimmerte. Manchmal summte er Worte, als würde er sie aus- und einatmen, als wären sie Teil einer Melodie, eine fremde Gewalt, die ihn irgendwann endlich ins Grab legte, eine Gewalt, von der er nichts wusste. Die Truthähne waren schon im Garten gewesen, als Rosarius zum ersten Mal im Pflegeheim aufwachte. Damals hatte er geglaubt, er wäre in der Unterwelt angekommen. Ständig hatte er von Peeh gesprochen und Passagen aus dem «Hyperion» geraunt und in fremden, selbst erdachten Sprachen geredet. Erst langsam war es ihm besser gegangen, hatte er wieder bestimmte Dinge und die Wirklichkeit wahrgenommen.
Aus Rosarius’ Mundwinkel rannen Speichelfäden. Er weigerte sich an diesem Abend, sein Essen einzunehmen. Annie fütterte ihn. Danach ging sie zum Klavier im Empfangsraum. Das Klavier hatte lange ungenutzt dort gestanden. Sie zog das staubige Tuch weg, legte es über eine Stuhllehne, ihre Finger berührten zaghaft die Tastatur. Sie hatte viele Jahre nicht mehr gespielt. Ihre Fingerkuppen erinnerten sich, als sie die Tasten spürten, wieder an Melodien, an Lieder, die ihre Mutter ihr als kleines Mädchen beigebracht hatte. Rosarius wurde aufmerksam, als er die ersten Töne hörte. Er begann zu summen, glaubte, diese Melodien zu kennen, summte, wie er als kleiner Junge gesummt hatte. Er schaukelte unruhig lächelnd in seinem Rollstuhl, bis er schließlich umkippte und hilflos auf dem Boden lag. Annie eilte hinzu, richtete ihn mithilfe einer Kollegin wieder auf, setzte sich zu ihm und versuchte ihn zu beruhigen.
Als Mitte der Fünfzigerjahre Vincentinis Holzgeschäfte nicht mehr gut liefen, verschwand er und war für einige Zeit wie vom Erdboden verschluckt. Seine Pension wurde verkauft, und wir zogen von Keldenich nach Kall, wo Kathy in der «Wäscherei & Reinigung» Moog unterkam. Sie nahm dort Kleidungsstücke entgegen, befestigte jeweils einen Zettel mit Nummern daran, legte sie in einen Korb. Danach wurde die Wäsche in einen Raum gebracht, wo sie durcheinander auf einem großen Haufen lag. Im Dunkel des fensterlosen Raums befanden sich nur Kleider. Ich lag oft den ganzen Tag unter ihnen. Sie schütteten Körbe mit Wäsche über mir aus. Anzüge, Röcke, Kostüme, Vorhangstoffe aus Seide und Wolle, Popelinemäntel, Ball- und Hochzeitskleider, Trikots der Fußballmannschaften, die Kittel des Apothekers, Sartorius’ Polizeiuniformen, Rüschenblusen der Kirchenchorsängerinnen, Delamots Friseurkittel, Anzüge des Schuldirektors, die Mieder...










