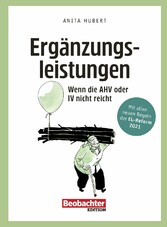
Ergänzungsleistungen - Wenn die AHV oder IV nicht reicht
von: Anita Hubert
Beobachter-Edition, 2021
ISBN: 9783038753537
Sprache: Deutsch
184 Seiten, Download: 1217 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Wenn das Geld
nicht reicht
55 Jahre Ergänzungsleistungen
Am 1. Januar 1966 ist das Ergänzungsleistungsgesetz in Kraft getreten. Nach 55 Jahren hat das Parlament das Gesetz nun einer Revision unterzogen. Die Ergänzungsleistungen, eine Erfolgsgeschichte, dank der viele Generationen von Rentnerinnen und Rentnern genug zum Leben haben.
Die Bundesverfassung verlangt, dass die AHV- und die IV-Renten das Existenzminimum decken. Doch weder im Jahr ihrer Einführung noch aktuell konnten und können Rentner allein mit der AHV- oder der IV-Rente ihren Lebensunterhalt bestreiten. Deshalb wurden die Ergänzungsleistungen geschaffen. Sie waren als Übergangslösung gedacht bis zur Einführung einer obligatorischen beruflichen Vorsorge, der Pensionskassen. Mit den Renten aus der 1. und der 2. Säule, so die Absicht, sollten Rentnerinnen und Rentner genügend Mittel zur Verfügung haben, um über die Runden zu kommen.
Wozu dienen die Ergänzungsleistungen?
Die Erwartung der Existenzsicherung hat sich nicht für alle erfüllt. Zwar funktioniert das System der beiden unterschiedlichen Säulen AHV und Pensionskasse im Vergleich zum Ausland heute gut, doch noch immer sind knapp 48,5 Prozent der Invalidenrentner und 12,7 Prozent der Altersrentnerinnen auf die Zuschüsse über die Ergänzungsleistungen angewiesen. Und die Tendenz ist steigend: 2019 wurden insgesamt 5,2 Milliarden Franken Ergänzungsleistungen ausgezahlt – doppelt so viel wie im Jahr 2000. 2019 bezogen 337 000 Menschen solche Zahlungen. Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV waren über doppelt so viele Frauen wie Männer auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Das zeigt, dass die EL mehr denn je dringend nötig sind.
Auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind heute einerseits junge Menschen mit Behinderung. Sie verdienen – wenn überhaupt – nur wenig und sind deshalb keiner Pensionskasse angeschlossen. Eine weitere grosse Bezugsgruppe sind pflegebedürftige ältere Menschen. Leben sie in einem Heim, reichen die Renten und das Ersparte meist nicht, um die hohen Kosten zu decken. So ersetzen die Ergänzungsleistungen einerseits fehlende Pensionskassenleistungen und andererseits die nicht vorhandene Schweizer Pflegeversicherung.
Die Ergänzungsleistung als Auffangbecken
Seit etlichen Jahren stehen die Schweizer Sozialversicherungen unter enormem Spardruck. Revisionen bei der AHV oder Invalidenversicherung führen zu Leistungsabbau. Hier dienen die Ergänzungsleistungen als Lückenfüller. Rentner, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren können, erhalten die dringend benötigten Mittel über die EL. Auch die Kostenexplosion bei den Krankenkassenprämien kann manches Budget ins Wanken bringen. In die Berechnung der Ergänzungsleistungen sind die hohen Krankenkassenkosten miteinbezogen, werden also mitfinanziert.
So gleichen die Ergänzungsleistungen die Probleme anderer Sozialversicherungen aus. Zum Glück – gäbe es die EL nicht, wären viele Rentnerinnen und Rentner auf Sozialhilfeleistungen oder auf Almosen angewiesen; Altersarmut wäre in der Schweiz allgegenwärtig.
Die EL-Reform 2021
Die Kosten der EL steigen massiv; im letzten Jahrzehnt haben sich die Ausgaben verdoppelt. Das blieb von der Politik nicht unbemerkt. Zahlreiche politische Vorstösse verlangten den Um- und Abbau der Ergänzungsleistungen. So wurde am 22. März 2019 vom Parlament eine Ergänzungsleistungsrevision beschlossen, die sogenannte EL-Reform.
Die wichtigsten Neuerungen sind:
■Mietzinsmaxima wurden je nach Region zwischen 10 und 25 % erhöht.
■Eine Vermögensschwelle wird eingeführt – alleinstehende Personen mit einem Vermögen ab 100 000 Franken und Ehepaare mit mehr als 200 000 Franken erhalten keine EL, dabei wird selbstbewohntes Wohneigentum nicht berücksichtigt.
■Der Vermögensfreibetrag wird gesenkt für Einzelpersonen auf 30 000 Franken, für Ehepaare auf 50 000 Franken.
■Das Vermögen, das übermässig ausgegeben oder auf das verzichtet wurde, wird angerechnet, als ob es noch vorhanden wäre.
■Erben von EL-Bezügern werden rückerstattungspflichtig, dies ab einem Erbe von 40 000 Franken.
■Der Lebensbedarf für Kinder unter 11 Jahren wird gesenkt, dafür können jedoch neu Auslagen für die Kinderbetreuung berücksichtigt werden.
■Bei der Krankenkassenprämie wird die Durchschnittsprämie der Region, höchstens aber die tatsächliche Prämie als Ausgabe berücksichtigt.
Der Übergang vom alten zum neuen Gesetz
Steht bisherigen EL-Bezügern durch die Reform ein höherer EL-Betrag zu, so erhalten sie diesen ab dem Jahr 2021. Wird die monatliche Ergänzungsleistung aufgrund der neuen Bestimmungen tiefer als bisher oder entfällt gar, wird dem EL-Bezüger noch während 3 Jahren der bisherige EL-Betrag ausbezahlt.
Weitere Informationen zur EL-Reform finden Sie im Anhang ab Seite 164.
Ergänzungsleistungen sind keine Sozialhilfe
AHV- und IV-Rentner, denen das Geld nicht zum Leben reicht, haben in der ganzen Schweiz einen Rechtsanspruch auf Ergänzungsleistungen. Trotzdem machen viele Menschen ihren Anspruch nicht geltend. Einige wissen nicht, dass sie diese finanzielle Hilfe beanspruchen dürfen – sie wurden falsch oder gar nicht informiert. Für andere ist das System der Ergänzungsleistungen gleichbedeutend mit Sozialhilfe – und Sozialhilfe möchten sie nicht beziehen, da würden sie sich schämen.
Das ist falsch: Ergänzungsleistungen sind keine Sozialhilfe und auch keine Almosen! Ergänzungsleistungen sind Versicherungsleistungen.
Sie müssen nicht zurückgezahlt werden, und es werden auch keine Verwandten dafür belangt – dies im Gegensatz zur Sozialhilfe. Allerdings wurde mit der EL-Revision 2021 eine Rückerstattung nach dem Erbgang eingeführt (siehe Seite 122)
Sozialhilfe kommt zum Zug, wenn alle Stricke reissen, wenn keine Versicherung mehr zahlt. Sie ist das unterste Netz im sozialen System der Schweiz. Die Sozialhilfe – veraltet Fürsorge genannt – ist nach kantonalen und oft auch gemeindeeigenen Vorgaben aufgebaut. Wer Sozialhilfe erhält, hat weniger Geld zur Verfügung als ein EL-Bezüger. Auch muss man Sozialhilfeleistungen zurückzahlen, wenn man wieder zu Geld gekommen ist. Und die Gemeinde kann Verwandtenunterstützung geltend machen (mehr dazu auf Seite 120). Zudem darf das Sozialamt in die Lebensgestaltung der Menschen eingreifen, indem es Auflagen macht und die Auszahlung an Bedingungen knüpft.
DIE ZUSTÄNDIGEN STELLEN FÜR ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN
Je nach Kanton nennen sich die Stellen, die für Ergänzungsleistungen zuständig sind, unterschiedlich: Bei den Gemeinden sind es meist die AHV-Zweigstellen, die kantonalen Stellen heissen Sozialversicherungs-anstalt, Sozialversicherungszentrum oder Ausgleichskasse. Wie das in Ihrem Kanton ist, sehen Sie in der Adressliste im Anhang oder unter www.ahv-iv.ch (→ Kontakte → Kantonale Stellen für Ergänzungsleistungen). In diesem Buch werden die Begriffe «Ausgleichskasse», «AHVZweigstelle» und «EL-Stelle» synonym verwendet.
Ganz anders die Ergänzungsleistungen: Wer die Voraussetzungen erfüllt, hat Anspruch auf den errechneten Betrag und erhält dieses Geld monatlich auf sein Konto ausgezahlt.
INFO Für Ergänzungsleistungen melden Sie sich nicht beim Sozialamt an. Denn das EL-Gesetz schreibt explizit vor, dass der Kanton keine Sozialhilfebehörden mit der Abwicklung der Ergänzungsleistungen beauftragen darf. Meist können Sie den Antrag in Ihrer Gemeinde bei der Ausgleichskassenzweigstelle oder direkt bei der kantonalen EL-Stelle einreichen.
Wer hat Anspruch auf Ergänzungsleistungen?
Damit Sie EL erhalten, braucht es als Grundvoraussetzungen eine Rente und einen Wohnsitz in der Schweiz. Die Ergänzungsleistungen werden als Aufstockung ausgerichtet – ohne Rente kann man sie, abgesehen von wenigen Ausnahmen, nicht beantragen. Anspruch auf EL haben folgende Personengruppen:
■AHV- und IV-Rentner
■Bezüger einer Hilflosenentschädigung
■Bezüger von Taggeldern der IV
■Bezüger von Witwen-, Witwer- und Waisenrenten
Der Anspruch besteht, wenn Ihre Einkünfte nicht reichen, um den minimalen Lebensstandard zu finanzieren. Was bedeutet «minimaler Lebensstandard»? Die EL geht von einem Minimum aus, das etwa einen Drittel höher liegt als dasjenige für Sozialhilfebezüger oder für Menschen, die auf dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum leben (siehe Seite 152).
TIPP Sie sind nicht sicher, ob Sie EL zugute haben?...










