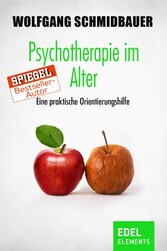
Psychotherapie im Alter - Eine praktische Orientierungshilfe
von: Wolfgang Schmidbauer
Edel Elements, 2013
ISBN: 9783955303310
Sprache: Deutsch
140 Seiten, Download: 1597 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
1. »Dafür bin ich zu alt!«
In jedem Kleide werd ich wohl die Pein
des engen Erdenlebens fühlen.
Ich bin zu alt, um nur zu spielen,
zu jung, um ohne Wunsch zu sein.
Goethe, Faust I
In dem Auf und Ab ihrer Stimmungen, angesichts der Schwankungen ihres Selbstvertrauens, ihrer Kräfte und ihrer Zuversicht suchen Menschen Halt bei etwas, das sich messen und zählen lässt. Seit wir unser Geburtsdatum wissen, ist das kalendarische Alter ein solcher Halt. Es sagt uns, wann es »Zeit« ist für etwas – für die erste Liebe, für den Abschluss der Ausbildung, für eine Gehaltserhöhung, für die Rente.
Die Formulierung »dafür bin ich zu alt« mischt subjektive und objektive Gesichtspunkte. So kommt sie einem wichtigen Abwehrmechanismus gegen seelische Veränderungen entgegen: der Rationalisierung. Da kalendarisches Alter unzweifelhaft objektiviert werden kann, sind die mit diesen objektiven Daten verknüpften Aussagen ebenso unangreifbar, sollen es wenigstens sein.
Wenn »zu alt« über einen anderen gesagt wird, ist es in der Regel die Aufforderung zu unscharfem Denken. Bei einem älteren Mitarbeiter muss der Vorgesetzte nicht über eigene Führungsfehler nachdenken, bei einem älteren Schüler der Lehrer nicht über seine pädagogischen Fähigkeiten, der Arzt nicht über die Diagnostik von komplexen Beschwerdebildern – es liegt eben am Alter, wenn der Mitarbeiter Probleme bereitet, der Schüler nicht lernt, der Patient nicht gesund wird.
Junge Erwachsene beginnen eine Therapie oft in der Erwartung, dass diese ihnen hilft, ihr Leben erst einmal zu erfüllen, den Beruf oder die Beziehung zu finden, von dem oder von der sie bisher nur träumten. Sie wünschen sich eine Familie, Kinder, ein eigenes Haus und möchten in der Therapie ihre Möglichkeiten verbessern, solche Vorstellungen zu realisieren.
Bei älteren Menschen ändert sich das. Das geschieht schrittweise und langsam, entspricht keineswegs dem kalendarischen Alter und unterscheidet sich bei Männern und Frauen. Aber insgesamt bewegt sich das Leben auf festere Strukturen zu. Die Angst, etwas nicht zu gewinnen, wird durch Ängste ersetzt, zu verlieren, was man schon gewonnen hat.
Nicht selten sagen ältere Menschen angesichts der Möglichkeit einer Psychotherapie »Dafür bin ich zu alt!«. Manchmal ist der Widerstand in dieser Äußerung relativ leicht zu erkennen.
Eine 50-jährige Reiseleiterin, in ihrem Beruf voller Ideen und sehr beliebt, soll wegen ihrer Asthmaanfälle, hohen Blutdrucks und gelegentlicher Depressionen eine Psychotherapie beginnen. Sie erzählt in den ersten Sitzungen eine traumatische Vorgeschichte: Sie wurde während der Pubertät von einem Freund des Vaters sexuell missbraucht.
Seither hat sie in ihren Liebesbeziehungen viel Pech gehabt. Sie wurde ausgenutzt, ein Partner war Alkoholiker, ein anderer gebunden. Diese Partnerwahlen hängen nach dem ersten Eindruck des Therapeuten (männlich, 61 Jahre alt) mit ihren Selbstgefühlsproblemen zusammen. Seit sie ihre körperlichen Symptome hat, fühlt sie sich zu einer sexuellen Beziehung nicht in der Lage. Inzwischen ist sie für diese Dinge nach ihrem energischen Bekunden »viel zu alt«.
Später entwickelt diese Patientin eine heftige erotische Übertragung und wirft dem Therapeuten vor, er quäle eine alte Frau mit Gefühlen, die nicht in ihr Leben passten. Sie habe bisher gedacht, dass im Alter von 50 Jahren die Sexualität vorläufig, im Alter von 60 Jahren aber definitiv abgeschlossen sei. So habe sie immer für über 60-jährige Männer geschwärmt, weil eine Frau sicher sein könne, von diesen in Ruhe gelassen zu werden. Diese Überzeugung habe der Therapeut zerstört, sie traue jetzt keinem 60-Jährigen mehr über den Weg.
Die Aussage »dafür bin ich zu alt« muss genauer untersucht werden; sie kann einen Reifungsschritt so gut anzeigen wie Widerstände gegen eine Veränderung und depressive Resignation.
Der 45-jährige Angestellte hat bisher achtmal die Stelle gewechselt, weil er nicht in der Lage war, sich in eine Hierarchie einzufügen. Er beharrte beispielsweise darauf, dass seine Leistung jedes Mal eigens ausgewiesen wurde, wenn ein Vorgesetzter sie präsentierte. Da diese Rücksichtnahme in vielen Unternehmen nicht üblich ist, gelang es ihm zuletzt mit Mühe, einen neuen Arbeitsplatz zu finden; er hatte nur dank seiner ausgeprägten und genau in das Anforderungsprofil passenden Qualifikationen eine Chance. Inzwischen hatte er mit einer Psychotherapie begonnen. Als nun auch der neue Chef seine Fähigkeiten »ausnutzte«, ohne ausdrücklich auf ihn hinzuweisen, sagte er nachdenklich: »Ich habe mich diesmal nicht mehr so aufgeregt wie früher. Vielleicht bin ich zu alt dafür, solche Eitelkeiten derart wichtig zu nehmen.«
Die 38-Jährige leidet unter ihrer Einsamkeit. Sie berichtet davon in einer therapeutischen Gruppe. Die Mitglieder machen Vorschläge: Sie könne doch eine Anzeige aufgeben, im Internet suchen oder einfach ein schönes Kleid anziehen und sich an einem Sommertag in ein Straßencafé setzen!
»Dafür bin ich zu alt«, ist die Antwort. »Das kann man vielleicht mit zwanzig machen, aber doch nicht in meinem Alter, da denken doch alle, ›seht die, die hat keinen abgekriegt!‹ Das ertrage ich nicht!«
Im 19. Jahrhundert waren Schaubilder in den Fibeln beliebt, auf denen das menschliche Leben als Stufenpyramide dargestellt war. Auf der linken, aufsteigenden Seite Säugling, Kleinkind, Schulkind, Jungfrau und Jüngling. Braut und Bräutigam krönten das Ganze. Dann der Abstieg: Elternschaft, rüstiges Alter, Greisenalter und Tod.
Heute lösen sich solche Systeme auf. Die Bilder sind individualisiert. Durchtrainierte Pensionisten schlagen ungeübte junge Männer im Sport. Eine 60-Jährige in Hollywood sieht jünger aus als eine 30-Jährige in den Slums. Dennoch haben sich im Hintergrund viele Fantasien erhalten, welche ein dem eigenen Alter »angemessenes« Verhalten nahe legen.
Die gegenwärtige Mischung aus Gültigkeit und Ungültigkeit der Lebensalterrollen befreit die vom Glück Begünstigten und Privilegierten. Aber sie verwirrt auch viele Menschen, die durch keine festen Zuschreibungen mehr gehindert werden, sich lange Zeit »zu jung« zu fühlen, um dann irgendwann zu erkennen, dass sie »zu alt« geworden sind.
Eine 52-Jährige, die mit großem Elan aus ärmsten Verhältnissen in eine akademische Karriere gefunden hat, vereinbart schockiert mit ihrem früheren Therapeuten einen Krisentermin. Sie hat erfahren, dass der Mann, mit dem sie vor sieben Jahren zusammen war, jetzt geheiratet hat, weil ein Kind unterwegs ist.
Damals hat sie auch daran gedacht, schwanger zu werden, war aber nicht überzeugt genug von der Beziehung und wollte noch warten. Sie hat es sogar ein paar Mal darauf ankommen lassen, als sie mit ihm schlief. »Ich habe immer gedacht, es ist noch nicht soweit, es ist irgendwie zu früh, ich bin zu jung. Aber ich habe nie gedacht, dass es irgendwann wirklich zu spät ist!«
Das Thema Wettlauf mit der Zeit ist zu allgemein, um als Oberbegriff für eine Psychotherapie im Alter zu stehen. Wer sich auf einen solchen Kampf einlässt, wird leichter entmutigt als nötig. Was immer möglich ist und gefördert werden sollte, ist das Eintauchen in Zustände der Zeitlosigkeit, die der Emotion und dem Unbewussten immer eigen sind – Angst und Trauer, Wut und Lust fühlen sich nach sechzig Jahren noch an wie eh und je; nur die Strukturen haben sich verändert, in denen sie sich entfalten.
Das Alter der Symptome
Nur in einem Punkt ist das Alter für die Psychotherapie wirklich bedeutsam: als Alter der Probleme, der Symptome, über die jemand berichtet. Für die Erfolgsaussichten einer Behandlung gilt in Medizin und Psychologie ein ähnliches Gesetz: Das Alter der Symptome ist wichtiger als das Alter der Kranken. Wenn ein 25-Jähriger, der seit seinem 14. Lebensjahr Drogen konsumiert, eine Therapie beginnen möchte, ist die Aufgabe für den Therapeuten erheblich schwieriger, sind die Aussichten auf Erfolg düsterer als angesichts eines 66-Jährigen, der seit einem Jahr an Angstzuständen erkrankt ist.
Gegenwärtig haben Frauen und Männer an der Pensionsgrenze noch rund dreißig Jahre vor sich. Diese Spanne wird sich in Zukunft eher verlängern als verkürzen. Die emotionalen Probleme, die sich in diesen Jahren entfalten können, sind vielleicht stürmischer als die der Dekaden vorher; Psychotherapie im Alter weist Parallelen zur Therapie von Heranwachsenden auf. Es geht um neue Strukturen, die gefunden werden müssen, und um den Abschied von Bestätigungen, die in der bisherigen Form nicht mehr funktionieren. Daher ist es auch gar nicht selten, dass in dieser Lebensphase gänzlich neue Symptome auftreten – Ängste, Depressionen, Hypochondrie.
Wiederholung und Neubeginn
Wenn sich das subjektive Zeiterleben im Alter beschleunigt, liegt das nicht zuletzt daran, dass wir Wiederholungen weniger Aufmerksamkeit schenken und sie als Routine in einem Zustand verminderter Aufmerksamkeit erledigen. So erinnern wir uns an eine dreiwöchige Fernreise ausführlicher und intensiver als an zehn Jahre gleichmäßiger Arbeit im Büro.
Angeblich ist die Mitte der erlebten Zeit bereits im Alter von zwanzig Jahren erreicht. Obwohl solche Objektivierungen in einem so subjektiven Erlebnisfeld nicht sonderlich aussagekräftig sind, kennt doch jeder Ältere aus eigenem Erleben, dass Tage und Wochen viel schneller vorbeiziehen.
Was sich in der Kindheit schier unübersehbar dehnte, ist überschaubar; die Sonne steigt zum Frühlings- und Sommerpunkt, dann sinkt sie wieder; die...










