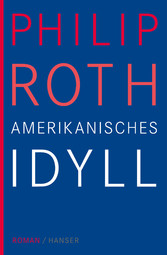
Amerikanisches Idyll - Roman
von: Philip Roth
Carl Hanser Verlag München, 2015
ISBN: 9783446251250
Sprache: Deutsch
464 Seiten, Download: 3788 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
2
Erinnern wir uns an die Aufbruchstimmung damals. Die Amerikaner regierten nicht nur sich selbst, sondern auch zweihundert Millionen Menschen in Italien, Österreich, Deutschland und Japan. Die Kriegsverbrecherprozesse befreiten die Erde ein für allemal von ihren Teufeln. Wir waren die einzige Atommacht. Rationierung und Preisüberwachung wurden aufgehoben; mit plötzlich erwachtem Selbstbewußtsein verlangten die Arbeiter der Autoindustrie, des Kohlebergbaus, der Transportwirtschaft, des Seehandels – kurzum, Millionen von Arbeitern verlangten bessere Löhne und traten dafür in Streik. Und sonntags morgens spielten sie Softball an der Chancellor Avenue und Basketball auf den Asphaltplätzen hinter der Schule, all die Jungen, die lebend zurückgekommen waren, Nachbarn, Vettern, ältere Brüder, die Taschen gefüllt mit Trennungsgeld, Männer, die jetzt, als vom Staat umsorgte Veteranen, Wege einschlagen konnten, von denen sie vor dem Krieg nicht einmal zu träumen gewagt hatten. Unsere Klasse kam sechs Monate nach der bedingungslosen Kapitulation der Japaner auf die High-School, im großartigsten Moment kollektiver Trunkenheit, den Amerika je erlebt hat. Und diese Aufbruchstimmung war ansteckend. Alles um uns her war lebendig. Opfer und Zwänge gab es nicht mehr. Die Wirtschaftskrise war überwunden. Alles war in Bewegung. Der Deich war gebrochen. Die Amerikaner fingen noch einmal von vorne an, und alle machten mit.
Und als ob das alles – der erstaunliche Abschluß dieser gewaltigen Ereignisse, das Zurückstellen der Uhr der Geschichte, die Tatsache, daß das Streben eines ganzen Volkes nicht mehr von der Vergangenheit behindert wurde – noch nicht beflügelnd genug gewesen wäre, gab es auch noch die Menschen in unserem Viertel und ihren gemeinschaftlich erklärten Willen, daß wir, die Kinder, fortan vor Armut, Unwissenheit, Krankheit, gesellschaftlicher Kränkung und Einschüchterung – und vor allem vor Bedeutungslosigkeit – bewahrt werden sollten. Ihr dürft nicht leer ausgehen! Macht was aus euch!
Trotz der unterschwellig vorhandenen Angst – einem täglich vermittelten Gefühl, daß Not eine ständige Bedrohung war, der man nur mit beharrlichem Fleiß zu begegnen hoffen konnte; trotz pauschalem Mißtrauen gegenüber der nichtjüdischen Welt; trotz der Angst vor wirtschaftlichem Ruin, die vielen Familien noch von der Depressionszeit in den Knochen steckte –, trotz alledem war unser Viertel nicht in Finsternis getaucht, sondern strahlte hell vor Betriebsamkeit. Es herrschte ein starker Glaube ans Leben, und man lenkte uns unerbittlich in Richtung Erfolg: Wir sollten es einmal besser haben. Das Ziel war, Ziele zu haben, die Absicht, Absichten zu haben. Diese Vorgabe war nicht selten von Hysterie geprägt, der kampfbereiten Hysterie derjenigen, die die Erfahrung gelehrt hatte, wie wenig Feindseligkeit es braucht, ein Leben ein für allemal kaputtzumachen. Und doch war es gerade diese Vorgabe – diese durch die Unsicherheit unserer Eltern, durch ihr Wissen um all das, was sich gegen sie verschworen hatte, mit Gefühlen überfrachtete Vorgabe –, was unser Viertel so fest zusammenhalten ließ. Eine ganze Gemeinschaft, die uns immerfort anflehte, nicht maßlos zu sein und nichts zu verpfuschen, die uns anflehte, die Gelegenheit zu ergreifen, unsere Vorteile zu nutzen und nie zu vergessen, worauf es ankommt.
Der Unterschied zwischen den Generationen war nicht gering, und es gab eine Menge Anlaß zum Streit: die Vorstellungen von der Welt, die sie nicht aufgeben wollten; die Regeln, die sie heilighielten und die für uns durch das Verstreichen weniger Jahrzehnte amerikanischer Zeit profan geworden waren; diese Unsicherheiten, denen sie und nicht wir unterworfen waren. Die Frage, wieweit wir uns von ihnen zu befreien wagen durften, zog sich durch unsere internen Debatten, ambivalent und aufgewühlt. Einige von uns brachten tatsächlich den Mut auf, sich gegen die hinderlichsten Ansichten der Älteren aufzulehnen, dennoch war der Generationenkonflikt nie so heftig wie zwanzig Jahre später. Das Viertel war nie ein Schlachtfeld, übersät mit den Leibern der Mißverstandenen. Gewiß setzte es manche Standpauke, um uns Gehorsam abzunötigen; die Fähigkeit der Jugend zur Auflehnung wurde durch tausend Bedingungen, Einschränkungen und Verbote im Zaum gehalten – Zwänge, die sich als unüberwindlich erwiesen. Einer davon bestand in unserer eigenen sehr realistischen Einschätzung dessen, was für uns am nützlichsten war; ein anderer in der alles beherrschenden Rechtschaffenheit jener Epoche, deren Tabus wir mit der Muttermilch eingesogen hatten; und nicht zuletzt gab es auch noch die etablierte Ideologie elterlicher Selbstaufopferung, die uns die mutwillige Aufsässigkeit austrieb und praktisch jede ungebührliche Regung im Keim erstickte.
Es wäre beträchtlich mehr Mut – oder Dummheit –, als die meisten von uns aufbringen konnten, erforderlich gewesen, hätten wir die leidenschaftlichen, unwandelbaren Illusionen der Älteren über unsere Perfektionierbarkeit zerstören und uns weit vom Erlaubten entfernen wollen. Daß sie uns aufforderten, zugleich gesetzestreu und besser als die anderen zu sein, geschah aus Gründen, die abzutun wir nicht mit unserem Gewissen vereinbaren konnten, und so traten wir eine ans Absolute grenzende Kontrolle an Erwachsene ab, die sich selbst durch uns zu erheben trachteten. Möglich, daß diese Konstellation zu gelinden Traumen geführt hat, aber ausgewachsene Psychosen sind, damals zumindest, nur in wenigen Fällen bekanntgeworden. Die Last all dieser Erwartungen war Gott sei Dank nicht so erdrückend. Natürlich gab es Familien, in denen es hilfreich gewesen wäre, wenn die Eltern die Bremse ein wenig gelockert hätten, aber im großen ganzen gab uns die Reibung zwischen den Generationen gerade genug Halt, um voranschreiten zu können.
Täusche ich mich, wenn ich denke, daß wir gern dort gelebt haben? Keine Illusionen sind verbreiteter als die, denen die Älteren durch Nostalgie erliegen, aber ist es eine vollkommen abwegige Vorstellung, daß Kinder, die im Florenz der Renaissance in wohlhabenden Elternhäusern aufwuchsen, nicht entfernt ein so gutes Leben hatten wie wir, die wir im duftenden Umfeld von Tabachniks Gurkenfässern groß geworden sind? Ist es eine abwegige Vorstellung, daß selbst damals, in der lebendigen Gegenwart, die Fülle des Lebens unsere Gefühle in ganz ungewöhnlichem Ausmaß erregt hat? Hat seitdem irgendein Ort euch so in seinem Meer von Details verschlungen? Das Detail, die Unermeßlichkeit des Details, die Macht des Details, das Gewicht des Details – die köstliche Endlosigkeit der Details, die euch und euer junges Leben umgaben wie die zwei Meter Erde, die man nach eurem Tod auf eure Gräber schaufeln wird.
Ein Viertel wie das unsere ist wohl naturgemäß der Ort, dem ein Kind spontan seine ungeteilte Aufmerksamkeit widmet; hier lernen Kinder ungefiltert die Welt verstehen, wie sie an der Oberfläche der Dinge zu sehen ist. Gleichwohl frage ich euch, fünfzig Jahre später: Habt ihr euch seither jemals wieder so vollständig geborgen gefühlt wie in diesen Straßen, wo jeder Block, jeder Hinterhof, jedes Haus, jede Etage in jedem Haus – die Wände, Decken, Türen und Fenster in den Wohnungen aller eurer Freunde – euch so absolut vertraut gewesen sind? Haben wir jemals wieder die mikroskopische Oberfläche all der so naheliegenden Dinge so treu verzeichnet wie damals, all die winzigsten Abstufungen in der gesellschaftlichen Rangordnung, die durch Linoleum und Wachstuch, durch jorzait-Kerzen und Küchengerüche, durch Ronson-Tischfeuerzeuge und Jalousien zum Ausdruck kamen? Wir wußten voneinander, wer was für ein Pausenbrot in seiner Tasche im Spind hatte und wer was bei Syd auf seinen Hot dog haben wollte; wir kannten aneinander jedes körperliche Merkmal – wer schiefe Füße hatte und wer schon Brüste hatte, wer nach Pomade roch und wer eine feuchte Aussprache hatte; wir wußten, wer von uns streitsüchtig war und wer von uns freundlich war, wer klug war und wer dumm war; wir wußten, wessen Mutter mit Akzent sprach und wessen Vater einen Schnurrbart trug, wessen Mutter arbeiten ging und wessen Vater gestorben war; irgendwie begriffen wir sogar vage, wie die unterschiedlichen Lebensumstände unserer Familien jede einzelne Familie mit einem anderen schwierigen menschlichen Problem konfrontierten.
Und dann gab es natürlich die unausweichlichen Turbulenzen, die aus Bedürfnis, Verlangen, Träumen, Sehnsucht und der Angst vor Schande entstanden. Mit seiner jugendlichen Selbstbeobachtung als einzigem Wegweiser versuchte jeder von uns, hoffnungslos pubertierend, allein und heimlich ein Ventil dafür zu finden – und das in einer Epoche, in der Keuschheit noch ein Wert war, ein nationales Anliegen, das sich die Jugend ebenso zu eigen machen sollte wie Freiheit und Demokratie.
Es ist erstaunlich, wie genau wir uns noch immer an alles erinnern, was uns als Klassenkameraden damals so unmittelbar vor Augen lag. Das intensive Gefühl, das wir empfinden, wenn wir einander heute sehen, ist nicht minder erstaunlich. Am erstaunlichsten aber ist, daß wir uns jetzt dem Alter nähern, in dem unsere Großeltern waren, als wir am 1. Februar 1946 zum erstenmal unser Klassenzimmer in dem Anbau betraten. Das Erstaunliche daran ist, daß wir, die wir keine Ahnung hatten, was aus alldem werden sollte, heute ganz genau wissen, was daraus geworden ist. Daß die Noten für die Abschlußklasse vom Januar 1950 feststehen – daß die unbeantwortbaren Fragen beantwortet sind und die Zukunft sich uns offenbart hat –, ist das nicht erstaunlich? Gelebt zu...










